

Heute haben wir für euch einen wunderschönen, literarischen Text von unserer Nutzerin Eva Woska-Nimmervoll. Der Text ist in folgender Anthologie erschienen:
„Lebenszeichen. Linkes Wort am Volksstimmefest 2015“, ISBN 978-3-9503485-5-2, Globus Verlag Wien.
1980. Ich bin allein zu Hause, es ist Sommer und ich suche nichts. Die Dokumentenmappe fällt mir in die Hände. Die Mappe ist aus einem braunen Material, das ein wenig so tut, als wäre es Leder. Es riecht fremd. Klarsichtfolien schützen Papiere vor Rissen, Flecken und Feuchtigkeit. Sie geben der Vergangenheit Halt. Wir brauchen Scheine und Zeugnisse, damit die Ämter wissen, dass wir und wer wir sind.
Ein Feld ist leer in Mamas Geburtsurkunde. Also es ist nicht wirklich leer. Es ist voll mit Strichen, eine ganze Zeile hindurch. Davor steht „Name des Vaters, Doppelpunkt“. Das wäre mein Großvater, doch Name steht hier keiner. Die Striche können sein: Bindestriche, Ersatzstriche, Gedankenstriche. Ich berühre mit dem Zeigefinger die Folie. 64 Striche ersetzen den Namen des Vaters meiner Mutter. Der erwartungsvolle Doppelpunkt vor dem Feld wirkt enttäuscht. Als gäbe es keinen Vater. Oder als wäre er erloschen bei einer missglückten Zeitreise. Ich weine und balle meine Hände zu Fäusten. Ich habe ein Recht auf einen zweiten Großvater wie jeder andere Mensch auch. Aus mir kommt ein Opa-Gefühl heraus und ich weiß nicht, wohin damit.
Später frage ich Mama, warum mein Opa, ihr Vater, nicht in ihrer Geburtsurkunde steht. Mama sagt, das ist zu kompliziert, sie kann mir das jetzt nicht sagen. „Und das andere, Mama, das versteh ich auch nicht. Warum hast du, als du noch nicht verheiratet warst, geheißen wie Oma, als sie noch nicht verheiratet war?“ „Oma war sehr jung“, sagt Mama, „ ich erkläre dir das später einmal, wenn du älter bist.“
Immer wieder Samstage bei Oma. Nachmittags Kaffeejause und Schwarzweißfilme mit Hans Moser, abends Rudi Carell, Kuli oder Anneliese Rothenberger. Drageekeksi in einer Glasdose. Ich darf beim Fernsehen auf dem Zierkissen mit dem gestrickten bunten Überzug sitzen und den Himbeersaft auf den Schemel neben mich stellen. Meine Schwester will das Barbapapa-Quartett spielen, ich aber nicht. Ich lese „Das Goldene Blatt“ und „Die neue Post“: Könige heiraten, Prinzessinnen aus Monaco und Schweden sind auf jedem Foto schön geföhnt, auch die ganz kleinen. Wahre Schicksalsberichte handeln von Männern, die Doppelleben führen, Säufer sind oder heimlich Schulden machen. Oma und Mama trinken Cherry Brandy. Oma sagt, sie freut sich, wenn wir Kinder da sind. Auch wenn nachher alles pickig ist.
Irgendwann krame ich in Omas Fotokiste. Vor dem Krieg, im Krieg, nach dem Krieg. Viele Fotos sind schwarz-weiß, auch die vom Friedhof und dem Sarg und den Soldaten. „Das war das Begräbnis von meinem Mann“, sagt Oma. Antworten wurden mitbegraben, Fragen nicht. Aber es war so, Krieg eben. Sie blieb allein, wie andere Omas auch.
Ist zehn Jahre später später genug, bin ich schon älter, Mami, erklärst du mir jetzt …? Meine Mutter lacht die Frage weg, bevor ich sie stellen kann. Sie sieht meiner Großmutter ähnlicher als früher. Wenn man die Oma-Ähnlichkeit aus dem Gesicht meiner Mutter subtrahiert, muss das, was übrig bleibt, wie mein Opa aussehen. Dichte Augenbrauen jedenfalls. Sie schenkt Kaffee ein und alles ist wie immer.
Wir sitzen im Hof vom Heurigen, Oma und ich. Sie bestellt noch ein Achterl, ich auch. Ihre Wangen sind rot. Wir reden über alte Zeiten. Sie sagt, dass es im Krieg früher ganz schwierig war, alles. „Was war da, Oma?“, frage ich statt: Was war da mit Opa?
Ich habe für mich im Geheimen eine Liste:
a) Inzest
b) Vergewaltigung
c) ein Priester
d) Oma eine Prostituierte
e) jemand Berühmter
f) eine Kombination zweier oder mehrerer der obigen Punkte.
Oma schüttelt den Kopf, durch ihre Brille sehe ich Tränen in den Augenwinkeln. „Daran will ich gar nimmer denken.“ Sie lächelt und sagt, dass es schön ist, dass ich Zeit gehabt hab, mit ihr zum Heurigen zu gehen. Ich hab Oma lieb, egal, was und wie schwierig es war. Wir stützen einander beim Nachhausegehen.
Als Oma stirbt, wird die Fotokiste auf unseren Dachboden übersiedelt, in Schachteln mit allem anderen zusammen.
Zwanzig Jahre später ist später genug. Heute will ich aus Ersatzstrichen Bindestriche machen. Einatmen. „Mami, du hast mir nie von deinem Vater erzählt, weißt du, wer er war?“ –„Krieg war“, sagt Mama. „ Und der Mann von Oma war an der Front. Oma war sehr jung. Und dann hat sie meinen Vater, einen Deutschen, kennengelernt.“ Sie sagt einen Vornamen und einen Nachnamen und den Namen einer Stadt in Deutschland. Oma wurde mit Mama schwanger, darum kam die Affäre heraus. Omas Mann ließ sich von ihr scheiden und fiel kurz darauf im Feld. „Und was war mit Opa?“ Mama sagt, er war nach Deutschland zurück gegangen, sehr bald danach. Überwies Geld, so lange sie klein war. Einmal sagte Oma zu Mama, schreib deinem Vater einen Brief. Mama sagt: „Was soll man jemandem schreiben, den man nie gesehen hat? Ich hab’s trotzdem versucht.“ Mama weiß nicht, ob Oma den Brief weggeschickt hat. „Aber, Mama, wolltest du nie …?“ Sie wollte nie.
Ich mache keinen Punkt. Ich möchte wissen, ob es meinen Opa noch gibt. Und Halbtanten, Viertelcousinen, Achtelneffen. Und ich will dem ganzen Zweig an Vorfahren nachgehen. Ich beschließe, dass es weh tun darf. Mir und anderen. Es darf kompliziert sein, ein Schock sogar. Ich suche nach Überlebenszeichen. Das Internet verschweigt Wesentliches, in dem es alles preisgibt, zu viele Übereinstimmungen werfen neue Fragen auf. Mein Mail an das Stadtarchiv in Deutschland wird mit einem Brief umständlich beantwortet. Datenschutz, Namensgleichheiten, Formalitäten. Mama sagt: „Lass es.“
Dreißig Jahre später ist zu spät. Die Familie ein Fragment. Vierundsechzig Gedankenstriche sind geblieben.
Alle sind verkühlt. Ich koche Suppe für die Kinder. Mimi hat kaum noch Fieber. Sie sitzt im Pyjama im Wohnzimmer und blättert in einem alten Fotoalbum. Das Seidenpapier bleibt an ihren Fingern kleben. Ich stelle ihr einen Teller mit Suppe hin. Sie blickt auf, ihre Augen sind glasig. „Du Mama, wieso …?“ – „Später, jetzt wird gegessen.“

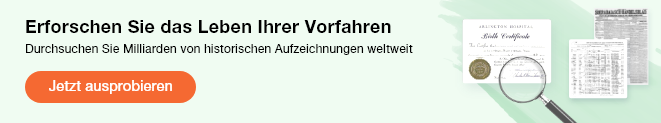






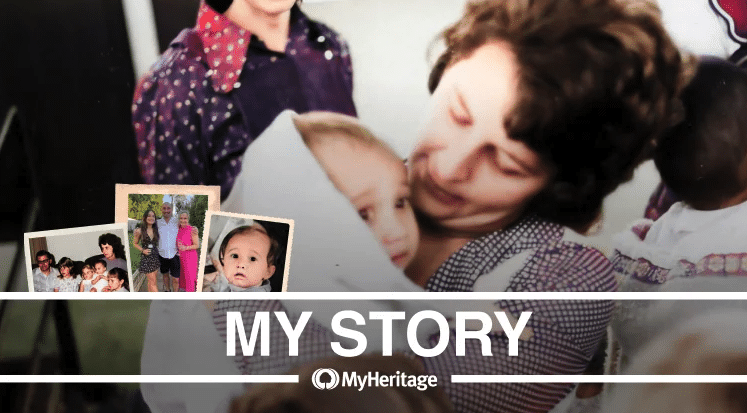


Erhard Johannes Bücker
27. Oktober 2017
Gut geschrieben,. Ich sehe vor meinen inneren Augen einen Film…