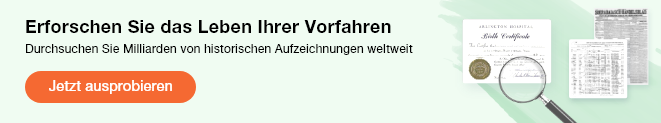Über 30 Jahre nach der großen „Staufer-Ausstellung“ in Stuttgart 1977 widmen die Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim dem bedeutendsten europäischen Herrschergeschlecht des 12. und 13. Jahrhunderts eine große kulturgeschichtliche Ausstellung.
In enger Zusammenarbeit mit der Universität Heidelberg, der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz und der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen wird eine Mittelalter-Schau präsentiert, die sich den innovativen Neuerungen und Entwicklungsschüben der Stauferzeit in drei Regionen, dem Rhein-Main-Neckar-Raum, Oberitalien und dem Königreich Sizilien zuwendet. Mit bedeutenden, zum Teil erstmals in Deutschland gezeigten, originalen Zeugnissen und Pretiosen wird die Geschichte, Kunst und Kultur des staufischen Zeitalters lebendig gemacht.
Das Jahr 2010 wurde zum Stauferjahr erklärt.
Das Geschlecht der Staufer prägte die Epoche zwischen 1150 und 1250 – mit Auswirkungen bis in die Jetztzeit. In den Reiss-Engelhorn-Museen – ohnehin eine hervorragende Adresse für historische Ausstellungen – wird der Bogen weit gespannt: von den staufischen Kernlanden an Rhein, Neckar und Main über Oberitalien bis nach Sizilien
Man sich dabei auf einen der größten Geschichtsschreiber der Zeit: Bischof Otto von Freising. Er pries jenes Dreieck zwischen Mainz, Frankfurt und Speyer als die „größte Kraft des Reiches“, die Po-Ebene als einen „Garten der Wonnen“ und Sizilien als „glückliche Insel“. Zwar war er als Onkel Kaiser Barbarossas wohl nicht ganz unbefangen, aber sein Urteil galt etwas. Wer nun – ganz EU-bewusst – drei „Innovationsregionen im mittelalterlichen Europa“ vorstellen wollte, wie der Untertitel der Schau verrät, musste also nur zugreifen. Dass sich damit gleich drei Bundesländer – Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen – als Geldgeber einspannen ließen, war ein willkommener Mitnahmeeffekt, und wertvolle Exponate zum Wirken der Staufer in Italien konnten den Reiz dieser Schau ja nur erhöhen. In Sachen Präsentation zieht sie nun auch alle Register. Die über 500 wunderbaren Dinge – von den Skulpturen über die Goldschmiedearbeiten, Handschriften, Textilien, Elfenbeinschnitzereien, Münzen und Urkunden bis zum 7,5-Tonnen-Sarkophag – sind großzügig arrangiert und effektbewusst durch Power-Point-Demos, Filme oder Architektur-Animationen belebt.
Die kostbare Welfenchronik, kurz vor 1200 im Kloster Weingarten geschaffen und auch als Stammbaum Barbarossas zu lesen, wurde aus Fulda entliehen – ist allerdings aus konservatorischen Gründen nur die ersten drei Monate zu sehen. In einer Nische steht zudem die archaisch-hoheitsvolle Muttergottes mit Kind aus der Schwäbisch Gmünder Johanniskirche. Zum anderen muss man eben zur Kenntnis nehmen, dass es die Staufer in ihrem Expansionsdrang aus der engeren schwäbischen Heimat fortgezogen hatte. In Worms war Barbarossa allein 19 Mal, in Mainz hielt er seine großen Hoftage ab, in Speyer wollte er begraben sein, und auf Italien richtete sich all sein imperiales Sinnen – die Musik spielte anderswo.
Wie sie spielte, ist nun auf rund 2300 Quadratmeter zu erleben. Zunächst tauchen die Mythen um die Staufer auf, bis hin zum Nazi-Wahn des „Unternehmens Barbarossa“. Die Protagonisten der Dynastie werden vorgestellt – auf Siegeln und Münzen, aber auch mit einem singulären Stück wie dem goldenen Barbarossakopf aus Cappenberg, einst Emblem der Stuttgarter Schau. Doch dann kommt bereits der Schwenk nach Italien, wohin sich die Staufer allein schon wegen des Machtanspruchs der römischen Kirche wenden mussten, wo sie aber auch ihre Vorbilder in der Antike fanden. Erlesene Werke aus den Hofwerkstätten – Büsten, Kelche, Schalen, Gemmen – belegen diese Identifikation.
Welch tief greifender Wandel in Gesellschaft, Wirtschaft, Religion und Kultur das Europa der Stauferzeit umtrieb, macht dann der Parcours durch die drei ausgeflaggten „Innovationsregionen“ deutlich. Drei Portale mit Herrscherporträts weisen jeweils den Weg: eine unbestimmbare Königsgestalt aus Speyer, die noch die alte Zeit atmet, eine Barbarossa-Karikatur aus Mailand, mit der die Lombarden wohl ihre Abneigung gegenüber den ungeliebten Herren aus dem Norden signalisierten, und schließlich die Büste des Barbarossa-Enkels Friedrich II. von der Porta Capuana, in der sich der Kunstsinn des gebürtigen Sizilianers manifestierte. Unweit davon steht dann auch der „Thronende König“ aus dem New Yorker Metropolitan, der das Logo der Mannheimer Schau abgab. Ob die exquisit gearbeitete Figur nun als staufische Machtdemonstration zu werten ist oder aber als anti-staufische Allegorie der Gerechtigkeit im Auftrag eines oberitalienischen Magistrats, lässt sich allerdings nicht sagen.
Unter dem Titel „Gelebte Vielfalt“ darf man ein buntes Panoptikum erwarten. Es wird wahrlich viel geboten – von der Kochkunst bis zur Falkenjagd, von der Dichtung bis zur Begräbniskultur. Besonders bemerkenswert: ein kleiner Grabstein aus Sizilien mit Inschriften in Hebräisch, Arabisch, Lateinisch und Griechisch, der eine bis dato unbekannte Offenheit im Umgang miteinander zeigt.
Diese Demonstration der dramatischen Wandlungen jener Zeit ist es schließlich, die die Ausstellung so anregend macht. Reich und selbstbewusst gewordene Städte entwickelten neue Verwaltungsformen, in jungen Universitäten strebten die Wissenschaften zu neuen Ufern, neue alternative Glaubensgemeinschaften wie die Franziskaner tauchten auf, und in den Künsten brachen sich neue Sichtweisen Bahn. Die Staufer mögen manches noch mit angestoßen haben, aber zu überzogen war ihr universeller Anspruch, zu stark wirkten Gegenkräfte, und im Endeffekt rollten viele dieser dynamischen Prozesse über sie hinweg.
Gleich am Eingang der Schau sitzt riesengroß der Barbarossa vom Kyffhäuser-Denkmal – aber aus rohem Karton, brüchig, rissig, in Auflösung begriffen. Man weiß sofort, woher der Wind weht. Mit ihrer Idee vom unangreifbaren, immerwährenden Sacrum Imperium sind die Staufer letztlich gescheitert – und dennoch unvergessen.
Vom 19. September 2010 bis zum 20. Februar 2011 in den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen. Katalog in zwei Bänden mit 800 Seiten und rund 1000 Abbildungen: 39,90 Euro in der Ausstellung, 59,90 Euro im Buchhandel. Tel: 0621 / 293 3150. Alle Infos über das umfängliche Rahmenprogramm: www.staufer2010.de. Spezielle Informationen für Ostwürttemberg: www.stauferland.de.
Quelle: SZon Foto: Flickr